Der Blinde Masseur
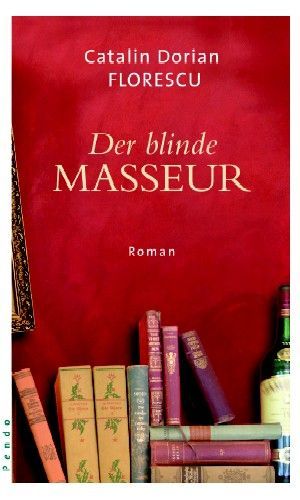
DER BLINDE MASSEUR
2006
Taschenbuch DTV
Irrfahrt zurück ins greifbare Leben
Die Irrfahrt - Anfang des Romans
Es gab noch ein Körnchen Schönheit. Solange ich das dachte, war ich sicher. Ich hatte die Grenze seit zehn Minuten überschritten. Der Pope sass neben mir und roch nach Knoblauch. Der Knoblauchgeruch wanderte von seinem Magen hinauf in seinen Rachen, dann in den Mund. Er hüllte uns darin ein, mich, seine Frau, den Jungen, den alten Waldarbeiter und sich selbst. Wenn er so weitermachte, würde ich ohnmächtig werden und gegen einen Baum fahren. An Bäumen mangelte es diesen Strassen nicht, an Kreuzen ebenso wenig.
Es waren wilde Landbäume, die nach allen Richtungen wuchsen, nur die Landkirchen wuchsen in den Himmel. Sie hatten Rückgrat. Unter den Bäumen standen Kreuze. Jedes Kreuz hatte seine Familie. Sie versammelte sich rundum und flüsterte: Hier ist es passiert. Der Ärmste. Dann erzählten sie sich das Leben des Ärmsten. Das waren dann Bäume mit Geschichten.
Alle paar Kilometer war das Land mit Toten gespickt, bis die erste Hilfe zu spät kam, lagen sie da und warteten. Vielleicht war das nicht der schlechteste Ausgang, wenn man aus dem Leben wollte. Man lag im Schatten, ein kleiner Wind kam und auch der Teufel, der nachschaute, ob er einen mitnehmen konnte.
Ich erinnerte mich, dass ich in meiner Jugend gesehen hatte, wie die Bauern Mohnsamen in den Sarg legten, damit der Tote sie abzählte und sich so vom Abschied ablenkte. Wie man aus den Mohnsamen das Schicksal des Neugeborenen erfuhr und die Anzahl der Münder, die man in seinem Leben füttern würde. Die Bauern glaubten an so etwas, dagegen konnten die Kommunisten nichts ausrichten.
Der Pope war für eine letzte Ölung gerufen worden, und er hatte gleich die ganze Familie mitgenommen. Es war eine Art Ausflug für Gott.
Der Mann ist an seinem bösen Herzen gestorben. Er hat niemandem etwas gegönnt, meinte der Pope, nachdem wir eine Weile gefahren waren.
In seinem Gebet aber hat der Pope nur das schwache Herz zugelassen, danach gab es reichlich Knoblauch, den er nun in meinem Auto los wurde. Insofern hatte auch ich etwas von der Ölung.
Ich beschleunigte und sah uns alle unter einem prächtigen Baum liegen, das Auto zertrümmert, über uns schwebte Knoblauchgeruch und vermischte sich mit den Gerüchen des Feldes. Bis man uns barg, musste man warten, damit er sich verdünnte. Dieses Land lag unter einer dichten Geruchsglocke. Sie wappneten sich alle täglich gegen den Teufel. Der hätte längst auswandern können, aber er harrte aus. Er liess sich Zeit. Die Zeit spielte ihm in die Hände.
Die Schuhe des Popen glänzten, ihm aber war das nicht genug, denn er rieb sie an den Hosenbeinen, zog sie aus, spuckte darauf und polierte sie mit dem Ärmel. Im Bart blieb ein bisschen Spucke hängen, die er mit der Hand wegwischte. Jetzt hatte er bespuckte Hände. Die Schuhe waren ihm wichtig, das merkte man gleich. Sie mussten ihn noch durch viele Ölungen und zu vielen gedeckten Tischen tragen.
Der Weizen schoss hoch, grün und zuoberst schon flaumig. Die Mohnblumen waren in der Luft aufgehängt, wie winzige Explosionen in Rot. Das Land war flach wie eine Handfläche, nach allen Richtungen sah man nichts, was den Blicken widerstand. Es war Mai, aber die Geschäfte, die mich hierher führten, waren keine Maigeschäfte, bei denen das Herz in Liebe höher schlug.
